Lesen, Schreiben, Rechnen
Verdacht auf eine Teilleistungsstörung
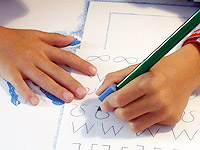 Wenn Lehrer, Eltern oder andere Bezugspersonen, die in engem Kontakt zu einem Kind stehen, das Gefühl haben, dass sich dieses in der Schule nicht gut entwickelt, könnte eine Teilleistungsstörung dahinter stecken. Insbesondere dann, wenn ein Kind auffällig schlecht liest und/oder schreibt, obwohl es in anderen Bereichen gut mitkommt (Legasthenie, LRS). Auch eine Problematik beim Rechnen bei guten bis durchschnittlichen Leistungen in anderen Fächern könnte auf eine solche Störung hinweisen (Dyskalkulie).
Wenn Lehrer, Eltern oder andere Bezugspersonen, die in engem Kontakt zu einem Kind stehen, das Gefühl haben, dass sich dieses in der Schule nicht gut entwickelt, könnte eine Teilleistungsstörung dahinter stecken. Insbesondere dann, wenn ein Kind auffällig schlecht liest und/oder schreibt, obwohl es in anderen Bereichen gut mitkommt (Legasthenie, LRS). Auch eine Problematik beim Rechnen bei guten bis durchschnittlichen Leistungen in anderen Fächern könnte auf eine solche Störung hinweisen (Dyskalkulie).
Gravierend sind dabei meist auch die Sekundärproblematiken, wie mangelndes Selbstwertgefühl, allgemeine Schulunlust, Prüfungsangst, Konzentrationsschwierigkeiten und Ähnliches, die durch ständige Misserfolge hervorgerufen werden.
Was ist Legasthenie?
Das Kind ist in der Entwicklung seiner Lese- bzw. Schreibfähigkeiten beeinträchtigt, ohne dass dies auf sein Entwicklungsalter, seine Beschulung oder auf Sehprobleme zurückzuführen ist. Meist sind auch Leseverständnis und/oder Grammatik betroffen. Die Intelligenz ist nicht beeinträchtigt.
Was ist Dyskalkulie?
Eine Beeinträchtigung der Rechenfähigkeit, die nicht durch eine allgemeine Intelligenzminderung oder unangemessene Beschulung zu erklären ist, wird Dyskalkulie genannt. Das Defizit betrifft die Beherrschung grundlegender Rechenfertigkeiten (Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division sowie die allgemeine Beherrschung des Zahlen-raumes), weniger die höheren mathematischen Fertigkeiten.
Therapiekonzept
 Die Therapie, die in der Regel in Einzelstunden, durchgeführt wird, umfasst eine kombinierte Lern- und Psychotherapie. Die Therapeutin kann sich auf die Bedürfnisse des Kindes einstellen und die Therapie genau auf dessen Bedarf abstimmen. Dabei werden sowohl die konkreten Fertigkeitsdefizite beim Lesen/Schreiben bzw. Rechnen behandelt, als auch die emotionalen und psychosozialen Probleme, die durch die Teilleistungsstörung entstanden sind. So wird das Kind ganzheitlich betrachtet und der negative Teufelskreis „Versagen – Selbstwertverlust – weiteres Versagen“ kann durchbrochen und später durch einen positiven Kreislauf „Erfolg – Steigerung des Selbstvertrauens – weiterer Erfolg“ ersetzt werden. Die Schritte dahin sind klein, aber wirkungsvoll. Die fundierte Beratung von Eltern und Lehrern gehört ebenfalls zum Therapiekonzept.
Die Therapie, die in der Regel in Einzelstunden, durchgeführt wird, umfasst eine kombinierte Lern- und Psychotherapie. Die Therapeutin kann sich auf die Bedürfnisse des Kindes einstellen und die Therapie genau auf dessen Bedarf abstimmen. Dabei werden sowohl die konkreten Fertigkeitsdefizite beim Lesen/Schreiben bzw. Rechnen behandelt, als auch die emotionalen und psychosozialen Probleme, die durch die Teilleistungsstörung entstanden sind. So wird das Kind ganzheitlich betrachtet und der negative Teufelskreis „Versagen – Selbstwertverlust – weiteres Versagen“ kann durchbrochen und später durch einen positiven Kreislauf „Erfolg – Steigerung des Selbstvertrauens – weiterer Erfolg“ ersetzt werden. Die Schritte dahin sind klein, aber wirkungsvoll. Die fundierte Beratung von Eltern und Lehrern gehört ebenfalls zum Therapiekonzept.
Erfolgsaussichten
Der Erfolg einer Therapie hängt von verschiedenen Faktoren ab: Wie geht es dem Kind emotional und psychisch? Kann es mittlerweile besser mit seinem Defizit umgehen? Meist kann die Situation der Kinder sowohl im Leistungsbereich als auch im psychischen Bereich verbessert werden. Maßgeblich ist dabei jedoch nicht zwingend die absolute Messlatte des Schulerfolges, sondern die individuelle Entwicklung des Kindes.
Wege zur Therapie und Kostenübernahme
Diagnose und Gutachten durch einen Kinder- und Jugendpsychiater bilden die Grundlage für die Therapie. Meist können die Kosten durch das Jugendamt übernommen werden. Eine Kostenübernahme durch die Krankenkassen ist in Verbindung mit Ergotherapie auch möglich.
Eine entsprechende Stellungnahme durch den Schulpsychologen kann einen Nachteilsausgleich erwirken, der dem Kind in der Schule Entlastung durch Aussetzen der Bewertung und Zeitzugaben bei Leistungstests verschafft.






